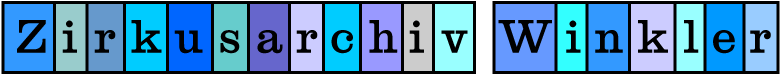Neuzugänge
Alessandra Litta Modignani
Il Circo de Ieri e di Oggi
Publistampa Edozioni, Pergine Valsugana 2024, 277 S., Fotos ISBN 978-88-85726-826, 30,- €
Dieser Band ist das Ergebnis einer Forschung, die es weltweit kaum oder gar nicht gibt. Eine Sammlung der Stammbäume von über 200 Zirkusfamilien in Italien, mit Informationen, die direkt bei ihren Mitgliedern gesammelt wurden. Die Forschung erfolgte mit einer Methode, von Platz zu Platz, von Zelt zu Zelt, von Wohnwagen zu Wohnwagen zu gehen und besonders den älteren Menschen zuzuhören. Eine laufende Forschungsarbeit, die dank der Leidenschaft von Alessandra Litta Modignani mittlerweile fast ein halbes Jahrhundert andauert. Der Band vereinigt Ergebnisse von dreißig Jahren Forschung und veröffentlicht 240 biografische Karten italienischer Zirkusfamilien (mit ihren jeweiligen Stammbäumen). 500 historische Fotos. 150 Glossareinträge mit den häufigsten Fachbegriffen und Angaben zu 11 monografischen Filmen über ebenso viele Protagonisten der italienischen Zirkusgeschichte.
För Künkel, Mirjam Hildbrand
Zirkuskunst in Berlin um 1900. Einblicke in eine vergessene Praxis
Verlag Theater der Zeit, Berlin 2025, 207 S., Abb. ISBN 978-3-95749-531-0, 45,- €
Das Bild vom Zirkus wird heute bestimmt von den Zeltanlagen und dem Wagenpark, der diese in der Regel umgibt. Bis zum Ausgang des 19. Jh. war ein Zirkuszelt eher die Ausnahme, bestimmend waren als Vorführungsstätten die festen Bauten. Die beiden Autorinnen haben mehrere Jahre zur Zirkuspraxis in Berlin um 1900 geforscht und in verschiedenen Archiven viele Dokumente und Fotos zu den entsprechenden Spielstätten gefunden, die einen Einblick in die Praxis der Zirkuskunst jener Zeit geben. Entstanden ist ein großformatiger Band mit zahlreichen bisher kaum bekannten und veröffentlichten Abbildungen. In Berlin existierten um die Jahrhundertwende der Zirkus an der Karlstraße, der aus einer ehemaligen Markthalle entstanden war, der sogenannte Wellblechzirkus des Circus Krembser am Friedrich-Carl-Ufer (heute Kapelle-Ufer) und der Circus Busch an der Kleinen Präsidentenstraße. Sie waren viel besuchte Stätten der Unterhaltung für breiteste Bevölkerungskreise und doch wird ihre Geschichte in der Forschung weitestgehend ausgespart. Ihre Spuren sind im Stadtbild heute nicht mehr zu entdecken, aber sie finden sich in den Archiven, Zeitschriften sowie heimatkundlichen und zirkushistoriografischen Publikationen. Sie verfolgt und ausgegraben zu haben, ist ein unbestreitbares Verdienst der beiden Autorinnen, wobei För Künkel künstlerisch forschende und praktizierende Szenografin und Kostümbildnerin ist, während Mirjam Hildbrand über das Konkurrenzverhältnis von Zirkus und Theater in Berlin um 1900 promovierte. Beide sind also prädestiniert, sich sowohl mit der Zirkusarchitektur wie der Technik und Ausstattung der Zirkuspraxis zu beschäftigen. Da geht es dann – neben der Architektur der Gebäude – unter anderem um mobile Kraftwerke und die Beleuchtung im Zirkus, den Einsatz von Film und Projektionen, um Wassermanegen, Drehbühnen und Hubpodien, die Kostüme, Requisiten und Bühnenbauten. Das alles wird belegt mit Fotos, Dokumenten und Bauzeichnungen, die eine Vorstellung davon geben, unter welchen Bedingungen damals Zirkus veranstaltet wurde. Es ist eine Entdeckungsreise in eine Zeit, als der Zirkus eine große kulturelle Bedeutung hatte und mehrere gleichzeitig spielende Zirkusse in Berlin Besucherscharen anzogen. Einleitend äußern sich verschiedene Autorinnen und Autoren, zumeist Zirkuspraktiker, über heutige Zirkusprobleme und schlagen so den Bogen von der Zeit um 1900 in die Gegenwart.
Filip Vincenz
Circusland Schweiz – eine Spurensuche
Weber Verlag Thun/Verlag Chateau & Attinger Orbe 2024, 224 S., Abb. ISBN 978-3-03818-595-6, 59,- €/59,- CHF.(Es erschien eine deutsche und eine französische und Ausgabe.)
Eine umfassende Geschichte des Circus in der Schweiz war schon lange fällig, denn bisher existierten nur Publikationen über einzelne Unternehmen. Filip Vincenz, Präsident der Circus-, Varieté- und Artistenfreunde der Schweiz CVA, hat nun dankenswerterweise diese Aufgabe übernommen und legt einen Band vor, der weit über die Geschichte der „fünf großen Unternehmen“ reicht und von den Spuren der Antike in der Schweiz über die Gaukler des Mittelalters bis in die Gegenwart mit den unterschiedlichsten Erscheinungsformen des Circus führt. Im Kapitel über die Gaukler finden sich nicht nur die Fahrenden des Mittelalters sondern auch „Gaukler“ der Neuzeit, die aufgrund ihrer Besonderheiten nicht als Circus zu definieren sind, sondern artistische Unternehmen darstellen wie beispielsweise der Einmanncircus „Maus“ oder die Sanddornbalance von „Rigolo“. Das nächste Kapitel widmet sich den Wandermenagerien von 1800 bis zu Conny Gassers „Flipper-Show“, René Stricklers Raubtierpark und der „Reptiles Expo“ von Anthony Guillod und Zoltan Prin, die bis heute erfolgreich reist. Natürlich dürfen auch die Hochseilschauen und Arenen nicht fehlen, der Autor erinnert an Namen wie Bügler-Tonelli, Bühlmann, Bauer, Stey und Hunziker. Die Geschichte des Circus in der Schweiz begann mit Théodore Rancy, der nach einem ersten Gastspiel 1865 in Genf 1876 einen eigenen Circusbau eröffnete, der allerdings später in ein Kino umgewandelt wurde und der einzige stationäre Circus in der Schweiz bleiben sollte. In einem Kapitel geht der Autor auf die vielen Gastspiele ausländischer Circusse in der Schweiz ein und kommt zu der Feststellung, dass die Schweiz ein begehrtes Circuspflaster für fast alle bedeutenden Circusunternehmen in Europa und sogar Übersee war und ist. Neben den Circusfamilien Knie, Nock, Gasser („OIympia“, „Royal“, „Starlight“, „Liliput“) und Stey, denen eigene Kapitel gewidmet sind, gab es zahlreiche Schweizer Circusunternehmen, die sich aber nur über einen begrenzten Zeitraum behaupten konnten, darunter „Pilatus“, „Schiener-Bühlmann“ und „Apollo“. Nach den ausführlichen Kapiteln über die großen Unternehmen folgen Beschreibungen der „Quereinsteiger“ wie Mauerhofers „Plättli“, „Helvetia“ von Daniel Maillard, „Medrano“ von Urs Strasser sowie „Aladin“ „Viva“, „Traum-Theater Valentino“, Pichlers “Harlekin“, „Beat Breu“ und der nach Deutschland gewechselte „Fliegenpilz“, von denen die meisten aber nur einige Zeit existierten. Eine Ausnahme stellt der Circus „Monti“ dar, der 1985 von Guido Muntwyler gegründet wurde und ein eigenes Konzept entwickelte. Die diversen Winter- und Weihnachtscircusse stellen den Abschluss des Bandes dar, der natürlich auch 250 historische und neue Fotos enthält und als Besonderheit damit aufwartet, dass mit zahlreichen QR-Codes der Zugang zu einer digitalisierten Filmdatenbank ermöglicht und so eine zusätzliche Dimension eröffnet wird. Dem Leser erschließt sich mit dem Buch das Bild einer vielfältigen und auf hohem Niveau stehenden Circuswelt in der Schweiz, dem Autor ist damit ein sehr verdienstvoller Überblick gelungen und er schließt eine Lücke in der europäischen Circusgeschichte. Ein Vorwort verfasste Charlie Chaplins Sohn Eugène Chaplin.
Jovan Andrić
Il Circo Colorato. The Artists and Marvels of Italian Circus Posters
Becom, Noordwijk 2024, 297 S., Abb.ISBN 978-94-6491-786-4, 64,95 €
Der Autor lernte in seiner Heimatstadt Belgrad verschiedene italienische Zirkusse kennen, die in Jugoslawien gastierten. Ihn faszinierte schon als Kind die Welt des Zirkus und er begann, die Plakate der italienischen Zirkusse zu sammeln. Seine Sammlung umfasst Plakate der 70er bis 90er Jahre. Das letzte Gastspiel fand mit „Embell Riva“ 2003 statt, da inzwischen Vorstellungen mit Wildtieren in Serbien verboten worden waren. Die umfangreiche Plakatsammlung von Jovan Andrić ist als virtuelle Galerie unter www.circus-collectibles.com zu finden. Das Buch ist geordnet nach den Künstlern, die die Plakate geschaffen haben. Einleitend werden sie mit einer Biografie und Ausführungen über ihre grafischen Arbeiten vorgestellt. Der Band umfasst 642 Abbildungen von sechs bekannten und einigen unbekannten Künstlern, vor allem aus der Sammlung des Autors. Das Buch gibt so einen Überblick sowohl über die italienische Zirkusplakatkunst wie die Zirkusse, denen sie zur Werbung dienten. Neben den italienischen sind auch Arbeiten dieser Grafiker für andere europäische Zirkusse wie Bouglione, Krone und Roncalli enthalten. Die Texte sind in Englisch und Italienisch, außer den Plakaten sind auch Skizzen abgebildet.
Henk van den Berg
Het Nederlandse Circus 1950 – 1960
Stichting Historische Circusuitgaven, Oss 2024, 142 S., Abb.
Der Band ist zu beziehen bei Stichting Historische Circusuitgaven, Laan der Romeinse tijd 53, 5347 HT Oss, e-mail hj.berg49@gmail.com, 40,- € plus 10,- € Porto.
Der Club van Circusvrienden Nederland wurde am 1. Juli 1949 durch den Journalisten Jo van Doveren, dem damaligen Pressechef des Circus Strassburger, und dem Hippologen Henri J. Lijsen ins Leben gerufen. Zu seinem 75-jährigen Bestehen erschien nun ein Bildband, den Henk van Berg in bewährter Weise betreut hat. Wie er in seiner Vorbemerkung schreibt, orientiert sich der Band an dem 1992 erschienenen Buch „De vijf Vijftigers“ von Dick H. Vrieling, also an den fünfziger Jahren in den Niederlanden, die durch die Circusse van Bever, Boltini, Mikkenie, Jos Mullens und Strassburger bestimmt wurden. Natürlich haben viele holländische Circusfreunde die Fotos zusammengetragen, die von dem Gestalter Jack Post zu einem Band zusammengefügt wurden. Es ist eine Fülle von historischen Aufnahmen, sowohl von den Zelten wie Auftritts- und Milieufotos, ergänzt durch Plakate und anderes Material. Im Gegensatz zu den anderen Fotobüchern von Henk van Berg wird hier auf jeglichen Text verzichtet, abgesehen von den Bildunterschriften. Das ist ein wenig schade, denn der Verweis auf das Buch von Dick H. Vrieling nützt natürlich nur bedingt und man hätte gern ein wenig mehr über diese fünf Circusse erfahren, die über längere Zeit das Circusgeschehen in den Niederlanden dominiert haben. Mit den Darbietungsfotos wird an viele bekannte Artistinnen und Artisten und auch Direktoren erinnert. Es wird ein Abschnitt der niederländischen Circusgeschichte ins Gedächtnis gerufen, der mit großen Namen verbunden war.
Ezra Le Bank, David Bridel
Clowns. In Conversation with Modern Masters
Routledge, London/New York, 2015, 46,25 €
Gespräche mit Clowns sind die Grundlage für das Buch, das der Theaterwissenschaftler Ezra Le Bank und David Bridel, künstlerischer Direktor der Clownschule in Los Angeles, zusammengestellt haben. Die Künstler geben darin Auskunft über ihren jeweiligen Werdegang, ihre Inspiration, Philosophie und ihre speziellen Techniken. Unter ihnen sind ausgesprochene Bühnenclowns wie Slava Polunin, Avner Eisenberg und Michail Usov, aber auch Zirkusclowns wie David Larible, Bello Nock, Barry Lubin, David Konyot und Oleg Popow. Andere wiederum sind gleichermaßen auf den Bühnen wie in den Manegen zuhause, beispielsweise Peter Shub, David Shiner, René Bazinet. Legendär Dimitri, der sein Können in seiner Schule weitergibt, und der „Vater“ der Clownpower Bewegung Jango Edwards. Sie alle und einige mehr – insgesamt sind es zwanzig – vermitteln einen repräsentativen Querschnitt durch die breit gefächerte gegenwärtige Clownszene. Jedes Kapitel wird mit einer Kurzbiografie und einem Porträtfoto (natürlich in Kostüm und Maske) eingeleitet, sie sind entweder als Interview oder als Selbstdarstellung gestaltet. Die Unterschiedlichkeit der Clowns genauso wie ihre künstlerischen Gemeinsamkeiten ergeben ein Bild der modernen internationalen Clownerie. Entstanden ist so ein Buch, das Zirkusfreunde wie Theaterwissenschaftler gleichermaßen anspricht und die Rolle des Clowns in den Unterhaltungsformen von Manege und Bühne charakterisiert. Dazu trägt auch das Einleitungskapitel bei, das sich mit der Geschichte der Clownerie beschäftigt. Im Anhang finden sich Erklärungen v. a. zu Personen, Unternehmen und Festivals sowie ein Register.
Andrew Payne
A World of Circus. A Pictorial History of Gerry Cottle’s Circus
Becom Publishers, Noordwijk, 2015, 49,95 €
Gerry Cottle (geboren 1945) gründete 1970 einen Zirkus und betrieb ihn die ersten Jahre gemeinsam mit Brian Austen, dem Hochseilartisten El Briarno, als Cottle & Austen’s Circus. 1974 trennten sie sich: Austen baute den Austen Brothers Circus auf und sein Partner den Gerry Cottle’s Circus. Cottle tourte durch die Welt, betrieb zeitweilig auch einen Eiszirkus und führte 1984 die erste reisende Zirkusschule in England ein. Er präsentierte den Moskauer Staatszirkus, veranstaltete gemeinsam mit Austen einen Weihnachtszirkus im Battersea Park Hippodrome, schickte zwei Zeltzirkusse auf Tournee und betrieb 1989 vier Christmas Shows in verschiedenen Städten. Eine große Rolle spielten in den Programmen immer die Tiernummern, z. B. die Raubtiergruppen von Sydney Howes, Dickie Chipperfield und Martin Lacey, die Pferdedarbietungen von Yasmine Smart und die Elefantengruppen mit Carlos Macmanus und Robert Raven. Andrew Payne zeichnet im ersten Band die Geschichte des Gerry Cottle’s Circus von 1970 – 1990 nach, ein zweiter Band über die Jahre von 1991 – 2015 soll 2016 folgen. Neben den Texten stehen natürlich die zahllosen farbigen Abbildungen von Plakaten, Fotos, Programmheften und anderem Werbematerial im Vordergrund. Ein sehr informatives, großformatiges Buch, das sowohl zum Lesen wie zum Blättern einlädt.
Tomi Purovaara:
Conversations on Circus Teaching
Mala Performerska Scena, Zagreb, 2014, 12 €, ISBN 978-9-5356-5092-8
Tomi Purovaara war Mitbegründer und von 2002 – 2012 Direktor des finnischen Cirko Center für Neuen Zirkus in Helsinki und ist heute Direktor des International Cultural Centre Caisa in Helsinki. Nach seinem 2012 erschienenen Buch „An Introduction to Contemporary Circus“ hat er nun ein Buch über die Aus¬bildung von Artisten geschrieben, das auf Interviews mit verschiedenen Zirkuspädagogen beruht. Es geht dabei um das Berufsbild des Zirkuslehrers, die Anforderungen an ihn und die Unterschiede in der Ausbildung zum klassischen oder neuen Zirkus. Weitere Kapitel beschäftigen sich mit den Problemen der Studenten und ihren Vorstellungen von der Ausbildung sowie den verschiedenen Formen der Zirkusschulen. Ein Abschnitt widmet sich der Zirkusausbildung in Frankreich. Die Diskussion unter den Vertretern der verschiedenen Zirkusschulen (z.B. École Nationale de Cirque Montreal, Codarts Rotterdam, NICA Melbourne, CNAC Châlons, Carampa Madrid, Circus Space London) zeigt Unterschiede in den Methoden, aber viele Gemeinsamkeiten in den Zielen der Artisten-ausbildung. Und einig sind sich alle auch darin, dass die umfassende Ausbildung der Zirkuslehrer die Voraussetzung dafür ist, dass die Artistenschüler sowohl eine breit gefächerte technische Grundlage für ihren Beruf bekommen wie Anregungen für ihre künstlerische Kreativität.